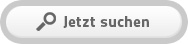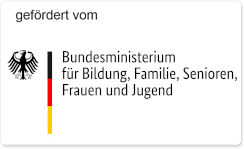Häufig gestellte Fragen:
Zielgruppe und Erreichbarkeit
 Für wen ist das Förderprogramm angedacht? Wer ist die Zielgruppe von „Kultur macht stark“? Wer kann an den Projekten teilnehmen? Für wen ist das Förderprogramm angedacht? Wer ist die Zielgruppe von „Kultur macht stark“? Wer kann an den Projekten teilnehmen?
Die Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche mit einem erschwerten Zugang zur Bildung im Alter zwischen drei und 18 Jahren, die in sozialen (z.B. Erwerbslosigkeit der im Haushalt lebenden Eltern), finanziellen (z.B. geringes Familieneinkommen, Erhalt von Transferleistungen) und/oder bildungsbezogenen (z.B. Eltern sind formal gering qualifiziert) Risikolagen aufwachsen. Des Weiteren zählen Kinder und Jugendliche mit körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen bzw. mit besonderem Förderbedarf zur Zielgruppe. Es können auch Kinder und Jugendliche an den Projekten partizipieren, die nicht einer der o.g. Risikolagen zuzuordnen sind; doch muss die Hauptzielgruppe stets im Fokus bleiben.
 Wo finde ich meine Zielgruppe? Wo finde ich meine Zielgruppe?
Über Anfragen bei sozialen Einrichtungen wie z.B. „Tafel“, Jugendämter, Sozialämter, Jugendtreffs, Fördervereine, Ansprechpersonen der Kommunen, Kontakte mit Schulen, Kindergärten oder weiteren bereits bekannten Kooperationspartnern etc.
 Wie weise ich nach, dass die an meinen Projekten teilnehmenden Kinder und Jugendlichen aus einer oder mehreren Risikolagen kommen? Wie weise ich nach, dass die an meinen Projekten teilnehmenden Kinder und Jugendlichen aus einer oder mehreren Risikolagen kommen?
Schriftliche Nachweise, Belege oder Bescheinigungen müssen nicht erfolgen, um eine (weitere) Stigmatisierung der Kinder und Jugendlichen zu vermeiden. Allerdings muss im Förderantrag plausibel, möglichst gestützt durch Zahlen oder Prozentsätze, dargelegt werden, dass und inwiefern die Teilnehmenden den Risikolagen zuzuordnen sind und wie der Zugang zu den Kindern und Jugendlichen gewährleistet wird. Datenmaterial oder Statistiken können in vielen Fällen z.B. über kommunale Einrichtungen wie Sozial- und Jugendämter oder Schulen bezogen werden. Wichtig: Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte sind nicht automatisch Teil der Zielgruppe. Diese Annahme ist diskriminierend.
 Wer kann Bündnispartner sein? Wer kann Bündnispartner sein?
Zum Gelingen von lokalen Bildungsbündnissen ist das Zusammenwirken von mindestens drei lokalen Bündnispartnern mit unterschiedlichen, einander ergänzenden Kompetenzen erforderlich. Jeder Bündnispartner muss auf lokaler Ebene verankert sein. Einzelpersonen sind als Bündnispartner ausgeschlossen.
Zusätzlich zur Musikschule als Antragsteller müssen damit mindestens zwei weitere Partner Teil des Bündnisses sein. Die Zusammensetzung der Bündnisse wird im Rahmen von MusikLeben 3 nach folgenden Beispielen empfohlen:
- eine sozialräumliche Einrichtung, z.B. eine Jugendeinrichtung oder -verband, Jugend- und Schulsozialarbeit, Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, kirchliche Institution oder Migrantenselbstorganisation
- und / oder ein formaler Bildungsort, z.B. KiTa, allgemeinbildende Schule, Einrichtung beruflicher Bildung. Achtung: Das Projektvorhaben muss außerhalb des Regelunterrichts und für die Teilnehmenden freiwillig sein. Projekttage und -wochen von Schulen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen förderfähig. Auch Projekte im Rahmen des Offenen Ganztagsschulbetriebs sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
- und / oder ein weiterer Träger der kulturellen Bildung, z.B. freie Theater, Volkshochschulen, Musikvereine, Blasorchester, etc.
Alle Bündnispartner klären miteinander, welchen Beitrag sie jeweils zum Erfolg des gemeinsamen Projektvorhabens leisten und welche konkreten Aufgaben sie übernehmen werden. Die Bündnisse sollen auf Dauer angelegt sein und klare Aufgaben und Zuständigkeiten definieren. Festgehalten wird dies in einer Kooperationsvereinbarung, die dem VdM bei Antragstellung vorzulegen ist. Bitte beachten Sie unsere speziellen Vorgaben für Kooperationen mit Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen.
Bestehende lokale Kooperationen, die sich bereits in der ersten oder zweiten Programmphase von 2013 bis 2017 bzw. 2018 bis 2022 bildeten, können ebenfalls in die Konzepte einfließen, sofern hier neue Angebote geschaffen werden, z.B. in Form eines Ausbaus, einer Anpassung oder Erweiterung der Projekte in Bezug auf Konzept- und Zielgruppenkonfiguration. Eine unveränderte Fortführung der Projekte der vorangegangenen Programmphase ist nicht möglich.
 Wie lokal ist lokal bei der Bildung „lokaler“ Bündnisse? Wie weit kann ich einen geografischen Rahmen setzen? Wie lokal ist lokal bei der Bildung „lokaler“ Bündnisse? Wie weit kann ich einen geografischen Rahmen setzen?
Für die Definition „lokal“ sind unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen:
Für die städtischen Bereiche wird die Zuordnung „lokal“ durch die „Nähe“ gegeben; in den ländlichen Bereichen/Strukturen (Gemeinden, Kreise oder an regionalen Landesgrenzen liegen) sind Gegebenheiten und Möglichkeiten der „Lokalität“ zu prüfen. Stadt- oder Bundeslandgrenzen stehen einer Bündnisbildung nicht per se entgegen. Die Bündniszusammensetzung muss im Antrag näher beschrieben werden.
 Können Einzelpersonen Bündnispartner sein? Können Einzelpersonen Bündnispartner sein?
Nein, Einzelpersonen können nicht den Status eines Bündnispartners im Projekt haben. Sofern sie nicht als Fachkraft mitwirken, können sie sich auch als Betreuerin oder Betreuer oder ehrenamtlich in das Projekt einbringen.
 Kann eine allgemeinbildende Schule oder ein sozialräumlicher Verein als Antragssteller fungieren? Kann eine allgemeinbildende Schule oder ein sozialräumlicher Verein als Antragssteller fungieren?
Nein, gemäß der Förderrichtlinie des BMBF und des vom BMBF bewilligten VdM-Förderkonzeptes MusikLeben 3 muss Antragsteller und federführende Bündnispartner eine öffentliche, gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Musikschule in Deutschland sein. Die Antragsteller sollen Erfahrungen im Umgang mit öffentlichen Projektförderungen vorweisen können. Eine Mitgliedschaft im VdM ist kein Förderkriterium.
 Kann man nach einer Antragsbewilligung als Bündnis oder als Bündnispartner wieder zurücktreten? Kann man nach einer Antragsbewilligung als Bündnis oder als Bündnispartner wieder zurücktreten?
Eine Bewilligung hat eine bindende Wirkung, ebenso der Kooperationsvereinbarung zwischen den Bündnispartnern. Ein Rücktritt muss mit der Bewilligungsstelle (VdM) geklärt werden.
 Ist das gleiche Projekt (im Sinne einer Fortsetzung des Projektes) mit einem neuen Partner ein neues Projekt, das man vollständig neu beantragen muss? Ist das gleiche Projekt (im Sinne einer Fortsetzung des Projektes) mit einem neuen Partner ein neues Projekt, das man vollständig neu beantragen muss?
Das Ausscheiden eines Bündnispartners und die Aufnahme des neuen Partners werden im Kooperationsvereinbarung festgehalten und muss mitgeteilt werden. Darüber wird im Einzelfall mit der Bewilligungsstelle (VdM) entschieden.
 Kann für administrative Arbeiten eines Bündnisses eine Honorarkraft beschäftigt werden oder ist die Verwaltung eines Bündnisses und dessen Maßnahmen in jedem Falle als Eigenleistung zu definieren? Kann für administrative Arbeiten eines Bündnisses eine Honorarkraft beschäftigt werden oder ist die Verwaltung eines Bündnisses und dessen Maßnahmen in jedem Falle als Eigenleistung zu definieren?
Die Verwaltung eines Bündnisses und dessen Projekte sind in jedem Falle als Eigenleistung zu definieren.
Das BMBF hat jedoch eine Verwaltungspauschale in Höhe von sieben Prozent der tatsächlichen Fördersumme eingeführt, um den Aufwand, der für die Koordinierung und Verwaltung der Bündnisse entsteht, zu würdigen.
Die Verwaltungspauschale beträgt sieben Prozent der anerkannten Ausgaben, bei Förderungen unter 7.000,- EUR mindestens 500,- EUR.
 Ist der Einsatz von sozialversicherten Beschäftigten Lehrkräften einer Musikschule förderfähig? Ist der Einsatz von sozialversicherten Beschäftigten Lehrkräften einer Musikschule förderfähig?
Sozialversicherte Beschäftigte Lehrkräfte einer Musikschule sind förderfähig, wenn diese in Teilzeit angestellt sind und für die Projektlaufzeit einer Aufstockung des Arbeitsvertrages vorgenommen werden kann.
 Wie können eingesetzte sozialversicherungspflichtig in Teilzeit beschäftigte Lehrkräfte einer Musikschule abgerechnet werden? Wie können eingesetzte sozialversicherungspflichtig in Teilzeit beschäftigte Lehrkräfte einer Musikschule abgerechnet werden?
Ab der dritten Förderphase und somit in MusikLeben 3 können Lohnbestandteile von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften abgerechnet werden. Hierfür muss allerdings eine Aufstockung des Arbeitsvertrages im Umfang der Projektbeteiligung stattfinden. Die Aufstockung von Vollzeitbeschäftigten ist nicht möglich. Auch kann die Aufstockung nur im Rahmen von Lehrtätigkeiten stattfinden. Administrative Aufgaben sind wie bisher nicht förderfähig und werden als Eigenleistung in die Projekte mit eingebracht. Alle Informationen finden Sie unter der Regelung zu den Personalausgaben.
Sollten Lehrkräfte in ihrer Freizeit bzw. im Rahmen einer Nebentätigkeitsgenehmigung am Projekt mitwirken wollen, gibt es die Möglichkeit, mit einem der Bündnispartner einen Honorarvertrag zu schließen. Allerdings darf die Bereitstellung von Fachkräften und die Abwicklung der Zahlungsmodalitäten nicht die ausschließliche Aufgabe des Bündnispartners sein. Aus dem Antrag muss plausibel hervorgehen, welche zum Erfolg des Projektes beitragenden Aufgaben die jeweiligen Bündnispartner übernehmen. Reine Verwaltungstätigkeiten werden nicht akzeptiert.
Es gilt: Grundlage der Bewilligung ist die Zusätzlichkeit des Projektes. Das Projekt darf in keiner Wechselwirkung zu bestehenden arbeitsvertraglichen Strukturen stehen. Das Reduzieren eines Stundendeputats einer festangestellten TVöD-Kraft beispielsweise, zugunsten einer freiberuflichen Tätigkeit, als Honorarkraft beim Bündnispartner während der Projektlaufzeit, ist nicht zulässig.
 Können Mitarbeitenden aus dem Bundesfreiwilligendienst bzw. Freiwillige des FSJ Kultur ebenfalls Honorare bekommen oder fällt der Einsatz unter die Eigenleistungen? Können Mitarbeitenden aus dem Bundesfreiwilligendienst bzw. Freiwillige des FSJ Kultur ebenfalls Honorare bekommen oder fällt der Einsatz unter die Eigenleistungen?
Während der regulären Arbeitszeit können Bundesfreiwillige oder FSJler nur im Bereich der Eigenleistungen eingesetzt werden. Ausnahmen bestehen nur, wenn der/die Freiwillige in der eigenen Freizeit, z.B. am Wochenende mitarbeitet.
 Inwieweit sind Honorarkräfte im Rahmen des Programms weisungsgebunden? Inwieweit sind Honorarkräfte im Rahmen des Programms weisungsgebunden?
Honorarkräfte sind grundsätzlich selbständig Tätige. Die Aufgabenteilung/Zuordnung muss vertraglich geregelt werden.
 Können bestimmte Referentinnen und Referenten extra für die Projekte qualifiziert werden? Können hierbei anfallende Ausgaben ersetzt werden? Können bestimmte Referentinnen und Referenten extra für die Projekte qualifiziert werden? Können hierbei anfallende Ausgaben ersetzt werden?
Nein, extra durchgeführte Qualifizierungen fallen unter Eigenleistungen.
 Gibt es ein Formblatt für die Honorarverträge? Gibt es ein Formblatt für die Honorarverträge?
 Sind Projekte in Kooperation mit Schulen möglich? Sind Projekte in Kooperation mit Schulen möglich?
Schulen dürfen als Bündnispartner auftreten. Allerdings dürfen Projekte nur außerhalb des Regelunterrichts stattfinden. In MusikLeben 3 dürfen Projekte auch an Projekttagen von Schulen stattfinden oder im offenen Ganztag. Allerdings muss die Teilnahme freiwillig sein und die Kinder müssen ein alternatives Angebot nutzen können. Die Teilnahme einer gesamten Schulklassen bzw. Stufe ist damit ausgeschlossen. Die Freiwilligkeit der Teilnahme müssen im Antrag und im Nachweis bestätigt werden.
Transfer- und Vernetzungsaktivitäten
 Wann können Fördermittel für die Transfer- und Netzwerkaktivitäten beantragt werden? Wann können Fördermittel für die Transfer- und Netzwerkaktivitäten beantragt werden?
Es können Fördermittel für Transfer- und Netzwerkaktivitäten mit beantragt werden, wenn Aktivitäten zur nachhaltigen Etablierung der Projekte geplant sind.
 Wie können die Aktivitäten aussehen? Wie können die Aktivitäten aussehen?
Die Aktivitäten sollen über die Projekte und die projektbezogene Bündnisarbeit hinaus wirksam werden. Teilnehmen an den Aktivitäten können Akteurinnen und Akteure, die zum Beispiel durch Expertise und Erfahrungen Angebote der kulturellen Bildung für die Zielgruppe von „Kultur macht stark“ langfristig sichern können. Hierzu gehören u.a. Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunalverwaltung, Politik, religiösen Einrichtungen, Schulen oder auch die Zielgruppe selbst. Bestehen die Treffen ausschließlich aus Vertreterinnen und Vertretern der Bündnispartner, sind diese nicht förderfähig.
Die Höhe der Förderung der Transfer- und Vernetzungsaktivitäten wird nach einer Veranstaltungspauschale berechnet. Mit dem Verwendungsnachweis ist eine Liste der Teilnehmenden abzugeben. Auf Basis dieser Liste wird die Höhe der Ausgaben entsprechend der Veranstaltungspauschale pro Teilnehmenden vom Förderer anerkannt. Zudem ist im Verwendungsnachweis ein kurzes Ergebnisprotokoll zu integrieren.
Förderumfang, Richtwerte, förderfähige Ausgaben
 Gibt es eine Ober- und Untergrenze bei der Beantragung der Fördersummen? Gibt es eine Ober- und Untergrenze bei der Beantragung der Fördersummen?
Für die Antragsteller und Bündnisse gilt: Die Richtwerte in den Formaten dienen der Orientierung für die Ausgabenkalkulation. Grundlage für die Richtwerte ist ein Katalog zuwendungsfähiger Ausgaben, der der BMBF-Förderrichtlinie und dem Zuwendungsvertrag zwischen BMBF und dem VdM entspricht. Eine Untergrenze der Fördersumme von 2.000 € ist einzuhalten.
Für einzelne Posten werden auf Basis vorkalkulatorischer Beträge maximale Ausgabenhöhen festgesetzt. Ausnahmen durch die lokalen Bündnisse sind möglich, müssen jedoch im Antrag dargelegt und eingehend begründet werden.
Diese Ausnahmen beziehen sich sowohl auf die Höhe der Ausgaben für die einzelnen Formate als auch auf zuwendungsfähige Ausgaben, die aufgrund der besonderen lokalen Bedingungen über die einzelnen Posten hinausgehen. Die zuwendungsfähigen Ausgaben bleiben dabei auf den BMBF-Katalog und die Förderrichtlinie begrenzt. Ausnahmen benötigen eine entsprechende Prüfung durch die VdM-Bundesgeschäftsstelle und das Auswahlgremium und finden Eingang in den Weiterleitungsvertrag.
 Sind Personalausgaben für die Antragsstellung und Organisation der Bündnisse auf lokaler Ebene förderfähig? Sind Personalausgaben für die Antragsstellung und Organisation der Bündnisse auf lokaler Ebene förderfähig?
Die Verwaltung eines Bündnisses und dessen Projekte sind in jedem Falle als Eigenleistung zu definieren.
Das BMBF hat jedoch eine Verwaltungspauschale in Höhe von sieben Prozent der tatsächlichen Fördersumme eingeführt, um den Aufwand, der für die Koordinierung und Verwaltung der Bündnisse entsteht, zu würdigen.
Die Verwaltungspauschale beträgt 7 Prozent der anerkannten Ausgaben, bei Förderungen unter 7.000,- EUR mindestens 500,- EUR.
 Musizierende aus einem professionellen Orchester sollen im Bündnis mitwirken. Sind die Orchesterdienste förderfähig? Musizierende aus einem professionellen Orchester sollen im Bündnis mitwirken. Sind die Orchesterdienste förderfähig?
Soweit diese Musizierenden als Referierende gemäß der Formate tätig sind, d.h. wenn sie außerhalb ihrer regulären Arbeit pädagogisch-künstlerisch mit den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist es möglich, diese über Honorarverträge zu beschäftigen.
 Wenn Medien als Partner im Bündnis mitwirken, können dann auch hierfür Honorare gezahlt werden? Wenn Medien als Partner im Bündnis mitwirken, können dann auch hierfür Honorare gezahlt werden?
Unter Bündnispartnern sind Auftragsverhältnisse grundsätzlich nicht förderfähig. Hinzu kommt, dass nur die direkte pädagogisch-künstlerische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sowie Betreuungsaufgaben förderfähig sind. D.h. Honorare für z.B. das Erstellen eines professionellen Imagefilms sind nicht förderfähig.
 Wie kann ich die Ehrenamtlichen für mein Projekt schulen? Werden anfallende Ausgaben hierfür auch ersetzt? Wie kann ich die Ehrenamtlichen für mein Projekt schulen? Werden anfallende Ausgaben hierfür auch ersetzt?
Ausgaben für die Schulung von ehrenamtlichen Kräften sind als Eigenleistungen anzusetzen, sind also nicht förderfähig.
 Können Beiträge für die Teilnahme erhoben werden? Können Beiträge für die Teilnahme erhoben werden?
Nein, denn Teilnahmebeiträge widersprechen dem Fördergedanken (siehe Gegenstand der Förderung gemäß der Förderrichtlinie des BMBF).
 Sind Bildungsgutscheine in dem Programm einsetzbar? Sind Bildungsgutscheine in dem Programm einsetzbar?
Bildungsgutscheine können bei „Kultur macht stark“ nicht zum Einsatz kommen. Die Teilnahme an den Projekten soll für die Kinder- und Jugendliche von 3 bis 18 Jahre kostenfrei gestaltet werden (siehe Gegenstand der Förderung gemäß der Förderrichtlinie des BMBF).
 Können weitere Bundesmittel in ein Projekt einfließen? Können weitere Bundesmittel in ein Projekt einfließen?
Eine Finanzierung durch weitere öffentliche Mittel ist ausgeschlossen.
 Muss die Anzahl der geleasten / gemieteten Instrumente identisch sein mit der Anzahl der Teilnehmenden? Muss die Anzahl der geleasten / gemieteten Instrumente identisch sein mit der Anzahl der Teilnehmenden?
Die Anzahl muss nicht identisch sein. Allerdings müssen die geleasten Instrumente von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden.
Antragsverfahren und Auswahl
 Welche Eigenleistungen muss ich im Antrag darstellen? Welche Eigenleistungen muss ich im Antrag darstellen?
Eigenleistungen können u.a. sein:
- Einsatz von hauptamtlichem Personal für Organisation und Koordination der Projekte, für deren Durchführung und Nachbereitung
- Einsatz von hauptamtlichem Personal der weiteren Bündnispartner (Musikpädagoginnen und Musikpädagogen / Lehrkräfte / Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter / Erzieherinnen und Erzieher etc.)
- Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Bündnisse durch Freiwillige und ehrenamtlich Helfende
- eigene Schulung der Freiwilligen und ehrenamtlich Tätigen
- Einbringen von Infrastruktur
- Einbringung von Sachleistungen (z.B. Räumlichkeiten, Instrumente, Versicherungen etc.)
 Wie flexibel sind die Projektformate bei der Dauer oder der Teilnehmendenzahl? Wie flexibel sind die Projektformate bei der Dauer oder der Teilnehmendenzahl?
Die Projektformate wurden in MusikLeben 3 überarbeitet und gliedern sich jetzt in fünf Kursformate und ein Freizeitformat. Die genannten Richtwerte sind keine Pauschalen, sondern bilden die Basis für die individuellen Projektkalkulationen. Die Auswahl eines Formates ist bindend und eine Mischung verschiedener Förderformate ist nur in begründeten Ausnahmefällen und in Abstimmung mit dem VdM-Projektbüro möglich! Änderungen bei der Teilnehmendenzahl, der Anzahl der eingesetzten Fachkräfte, den pädagogischen Konzepten und Zielen ist nur in begründeten Fällen möglich. Anpassungen beispielsweise beim Betreuungsschlüssel in inklusionsorientierten Projekten sind bei der Antragstellung mit dem Projektbüro abzusprechen.
 Sind Eigenleistungen in Geld umzurechnen bzw. zu beziffern? Sind Eigenleistungen in Geld umzurechnen bzw. zu beziffern?
Nein, Eigenleistungen sind NICHT in Geld umzurechnen.
Es ist zu unterscheiden zwischen Eigenleistungen und Eigenmitteln. Nur Eigenmittel (z.B. 500,-€) sind in Geld anzugeben, weil es sich um konkrete Finanzmittel beispielsweise der Musikschule handelt, welche diese in das Projekt einfließen lässt.
Eigenleistungen (z.B. Räumlichkeiten, Infrastruktur etc.) hingegen müssen zwar erbracht und dargestellt, aber NICHT in Geld beziffert werden und sind NICHT in das Projekt hineinzurechnen. Werden Eigenmittel in das Projekt eingebracht, reduziert sich die Förderquote um den entsprechenden Prozentsatz. Dies bedeutet jedoch, dass auch alle noch zu tätigenden Ausgaben nur zu diesem Prozentsatz gefördert werden können. Wenn Sie keine Eigenmittel einbringen, beantragen Sie eine Förderung in Höhe von 100%.
 Inwiefern ist die Umsatzsteuer im Programm zu beachten? Inwiefern ist die Umsatzsteuer im Programm zu beachten?
Das Förderprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ selbst ist nicht umsatzsteuerpflichtig. Das bedeutet, für die bewilligten Mittel müssen keine Steuern abgeführt werden.
Musikschulen müssen bei Rechnungen für Ausgaben im Rahmen bewilligter Mittel für deren „Kultur macht stark“-Projekte ganz regulär die Umsatzsteuer zahlen und können entsprechende Ausgaben inkl. MwSt. beantragen, es sei denn, sie sind vorsteuerabzugsberechtigt. In diesem Falle einer Vorsteuerabzugsberechtigung dürfen die Musikschulen auch nur Nettobeträge als Fördermittel beantragen.
Beim Abschließen von Honorarverträgen, die wie Rechnungen zu werten sind, ist der Status des Vertragspartners entscheidend. Selbstständige (Freiberuflerinnen und Freiberufler, die unter die Kleinunternehmer-Regelung fallen,) sind für die Versteuerung ihres Honorars selbst verantwortlich.
 Wie erhalte ich eine Rückmeldung auf meinen eingereichten Antrag? Wie erhalte ich eine Rückmeldung auf meinen eingereichten Antrag?
Durch eine Benachrichtigung an die in der Förderdatenbank hinterlegte E-Mail-Adresse. Die E-Mail wird, sobald der Antrag akzeptiert oder abgelehnt wurde, automatisch verschickt. Dies sollte nicht länger als drei Wochen nach Einreichfrist passiert sein. Nur vollständige und eingereichte Anträge werden der Jury vorgelegt.
Bewilligung, Auszahlung und Nachweis
 Wie funktioniert die Ratenauszahlung? Wie funktioniert die Ratenauszahlung?
Mittelabrufe erfolgen durch die Antragssteller nach den anfallenden Ausgaben. Der erste Abruf muss spätestens 3 Monate nach Projektstart erfolgen. Abgerufene Mittel müssen dann (Vorschrift vom Bundesrechnungshof) innerhalb von sechs Wochen nach Zahlungseingang auf dem Konto verausgabt werden oder bereits verausgabt worden sein. Andernfalls können Zinspflichten entstehen. Es ist wichtig, möglichst präzise abzuschätzen, welche Ausgaben innerhalb der sechs Wochen tatsächlich anfallen. Ein Abruf der verausgabten Mittel hat regelmäßig zu erfolgen. Ein Gesamtabruf der bewilligten Mittel zum Abschluss des Projektes ist nicht möglich. Mehr Informationen zu Zahlungsabrufen.
Der letztmögliche Abruftermin liegt im Haushaltsjahr immer Anfang Dezember. Für das entsprechende Kalenderjahr abgerufene Mittel können NICHT ins Folgejahr verschoben werden.
 Was geschieht mit Geldbeträgen, die nicht vollständig ausgegeben werden? Was geschieht mit Geldbeträgen, die nicht vollständig ausgegeben werden?
Nicht verausgabte Mittel müssen zurück überwiesen werden.
 Was geschieht mit den Dingen, die für die Projekte angeschafft wurden, nach Beendigung der Projekte? Was geschieht mit den Dingen, die für die Projekte angeschafft wurden, nach Beendigung der Projekte?
Anschaffungen (sogenannte Investitionen) müssen zunächst inventarisiert werden. Nach Projektende müssen Anschaffungen (unter Einbezug der Wertminderung etc. / Stichwort Abschreibungen) veräußert und die Einnahmen daraus zurückgezahlt werden. Aufgrund des daraus entstehenden hohen Verwaltungsaufwandes sind Investitionen nur in Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Rücksprache mit dem VdM förderfähig. Aus diesem Grund dürfen auch keine Instrumente angeschafft, sondern ausschließlich gemietet bzw. geleast werden. Instrumente, die in der Anschaffung günstiger sind als in der Anmietung, bilden hierbei eine Ausnahme. Die geplanten Kosten müssen als Kalkulationsübersicht bei der Antragstellung eingereicht werden, sodass das Projektbüro über die Notwendigkeit der Anschaffung entscheiden kann.
 Kann auch einer der Bündnispartner oder ein Förderverein der Musikschule die finanzielle Abwicklung des Projektes über dessen Konto übernehmen? Kann auch einer der Bündnispartner oder ein Förderverein der Musikschule die finanzielle Abwicklung des Projektes über dessen Konto übernehmen?
Nein, denn Antragsteller und Rechnungsempfänger ist die öffentliche Musikschule. Entsprechend muss ein (zweckgebundenes Buchungs-)Konto der Musikschule angegeben sein. Entscheidend ist, dass die Musikschule durch das Unterzeichnen des Zuwendungsvertrags rechtsverbindlich für die zweckgebundene Verwendung der Fördermittel verantwortlich ist und schlussendlich dafür haftet, wenn die Mittel nicht ordnungsgemäß verwendet wurden. Aus diesem Grund fließen keine Mittel auf Konten anderer Institution, seien es Fördervereine oder andere Bündnispartner.
|
|